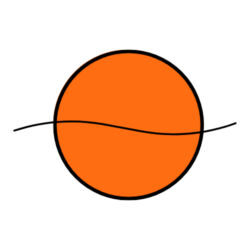Ich habe gerade ein Buch gelesen, das ich Ihnen vorstellen möchte. Es heißt „Green Crime“ von der Kriminalpsychologin Julia Shaw. Die Presse übertrifft sich gegenseitig in ihren positiven Rezensionen. Und ihre These klingt erstmal ganz einleuchtend, nicht?
Sie sagt: Hört auf, euch für euren Konsum schuldig zu fühlen. Die wahren Verbrecher sind nicht wir, die eine Avocado kaufen oder ein T-Shirt aus Bangladesch tragen. Die wahren Verbrecher sind die Konzerne, die wissentlich Wälder abfackeln, die Manager, die Emissionstests manipulieren, die kriminellen Netzwerke, die geschützte Arten ausrotten. Und die gute Nachricht ist: Gegen diese Leute können wir ganz genauso vorgehen wie gegen andere Kriminelle auch. Mit Ermittlern, Gesetzen und Gefängnisstrafen. Sie hat dafür ein Modell mit sechs Säulen entwickelt – ein Netzwerk aus Gier, Einfachheit und Bequemlichkeit, Straflosigkeit – das man nur zum Einsturz bringen muss.

Es fühlte sich beim Lesen an wie eine große Erleichterung. Da ist endlich jemand, der das schlechte Gewissen von meinen Schultern nimmt, das immer an mir nagt, wenn ich eine Banane esse oder ein Paket im Versandhandel bestelle. Es ist nicht MEIN Problem. Es ist ein JUSTIZPROBLEM. Wir müssen nur die Polizei besser ausstatten. Klingt logisch. Klingt machbar. Klingt beruhigend.
Aber dann, nicht lange nachdem ich das Buch zugeschlagen hatte, kamen die anderen Gedanken. Die unruhigen.
Dieses ganze Modell baut darauf, den „Bösen da draußen“ das Handwerk zu legen. Es ist ein äußerst befriedigendes Gefühl, einen Schuldigen zu haben. Aber was, wenn das System selbst die Bösen erschafft? Shaw spricht von „Gier“ als einer Säule. Aber sie fragt nicht: In welchem System wird Gier nicht nur geduldet, sondern zur obersten Tugend erklärt? In dem jeder CEO, der für den Quartalsgewinn einen Fluss vergiftet, von den Aktionären gefeiert wird? Ihr Ansatz sagt: Schwächt die Gier. Mein Kopf fragte: Warum stärken wir nicht aktiv etwas anderes? Wo lernen künftige Manager etwas über Gemeinwohl, über die Würde der Natur, über Verantwortung, die über den Shareholder-Value hinausgeht? Nicht in den meisten Vorlesungssälen der Wirtschaftshochschulen.
Und dann dieser Fokus auf die Strafverfolgung. Natürlich brauchen wir das. Aber es ist wie bei einer Krankheit, bei der nur die akuten Symptome mit einer starken Medizin behandelt werden, man aber nicht nach der Ursache der Immunschwäche fragt. Die wahre Prävention, dachte ich, fängt viel früher an. In der Schule. Warum lernen Kinder mehr über Bruchrechnen als über die Kreisläufe des Waldes vor ihrer Haustür? Warum wird ein Gefühl für die Verletzlichkeit und Schönheit unseres Planeten nicht genauso grundlegend vermittelt wie Lesen und Schreiben? Ein Kind, das eine Kaulquappe beobachtet, wird als Erwachsener vielleicht weniger leicht einen See zuschütten. Das ist keine naive Träumerei, das ist psychologische Grundlage.
Am meisten stolperte ich über das Wort „wir“. „Wir“ müssen die Gesetze durchsetzen. Aber wer ist „wir“? Der Gedanke an die unterbezahlte Umweltbehörde in einem ressourcenreichen Land des globalen Südens, die gegen einen multinationalen Konzern mit einer Armee von Anwälten ermitteln soll, ließ mich aufschrecken. Das Buch zeichnet das Bild eines fairen Spiels, bei dem wir nur den Schiedsrichter stärken müssen. Es erzählt nicht von dem schiefen Spielfeld, das durch Kolonialgeschichte, unfaire Handelsverträge und ökonomische Abhängigkeiten geschaffen wurde. Wenn ein europäisches Unternehmen illegalen Tropenholzhandel finanziert, ist dann der korrupte lokale Beamte der Haupttäter? Oder sind wir es, die mit unserem System der Nachfrage und des Profits diesen ganzen Teufelskreis am Laufen halten?
Das Buch hat mir eine klare, handliche Schublade gegeben, in die ich den ganzen Frust über die Umweltzerstörung stecken kann: die Schublade „Green Crime“. Es ist eine sehr bequeme Schublade. Sie entlastet mich persönlich und bietet einfache Feindbilder.
Aber die wirklich unbequeme Wahrheit ist, dass diese Schublade zu klein ist. Sie fasst nicht die Tatsache, dass ich Teil des Systems bin, das diese Verbrechen nicht nur bestrafen kann, sondern auch hervorbringt. Sie fasst nicht die langsame, unsichtbare Arbeit an unseren eigenen Werten und an unserer Bildung, die nötig ist. Und sie fasst schon gar nicht die unbequeme globale Solidarität, die über reine Strafverfolgung hinausgeht.
„Green Crime“ ist ein brillanter, wichtiger und notwendiger Anfang. Es weist den Weg zu den Werkzeugen, mit denen wir bereits lodernde Brände löschen können. Aber die eigentliche, langfristige Arbeit beginnt jederzeit: Unsere Gesellschaft muss lernen, verantwortungsvoll mit dem „Feuerzeug“ umzugehen – mit unserer gewaltigen technologischen und wirtschaftlichen Kraft.
Die Streichhölzer sind nicht das Problem. Das Problem ist die gedankenlose oder bewusst zerstörerische Hand, die sie entzündet. Unseren Kindern – und uns selbst – müssen wir deshalb beibringen, welches Feuer wärmt und welches alles niederbrennt. Wir müssen die Wahl sehen: Will ich ein Funke sein, der eine Kaskade der Zerstörung in Gang setzt? Oder einer, der ein Licht entzündet, das uns den Weg in eine lebenswerte Zukunft weist?
Das Buch gibt uns die Blaupause, um die Brandstifter zu stellen. Die viel schwierigere, tägliche Aufgabe aber bleibt: Uns immer wieder zu fragen, ob wir gerade Fluch oder Segen sein wollen – und unser Handeln danach auszurichten.
Reflexionsfragen
Hier sind einige Reflexionsfragen, die den Perspektivwechsel des Artikels vertiefen und zur persönlichen wie gesellschaftlichen Auseinandersetzung anregen.
Persönliche Haltung und Entlastung
- Beim Lesen der Buchthese („Die Schuld liegt bei den Kriminellen, nicht bei den Konsumenten“): Fühlten Sie sich dabei primär entlastet oder entmündigt? Was überwiegt: das Gefühl der Erleichterung oder der Sorge, dass Ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten (z.B. durch Konsum, politische Wahl) damit an Bedeutung verlieren?
- Die Autorin stellt das individuelle „schlechte Gewissen“ (z.B. wegen Flugreisen, Verpackungsmüll) dem systemischen Konzept der „Schuld“ gegenüber. Wo spüren Sie selbst diesen Widerspruch zwischen persönlicher Verantwortung und ausweglos erscheinenden Systemzwängen in Ihrem Alltag?
Systemische Perspektive und Werte
- Das Modell der „sechs Säulen“ konzentriert sich darauf, kriminelle Anreize (Gier, Straflosigkeit) zu schwächen. Welche konkreten gesellschaftlichen Werte, Belohnungen oder Anreize müssten stattdessen gestärkt werden, um ein System zu schaffen, in dem nachhaltiges Handeln nicht die heldenhafte Ausnahme, sondern die naheliegende Norm ist?
- Der Artikel kritisiert, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung (z.B. ein Gefühl für ökologische Kreisläufe) im Lehrplan oft fehlt. Welche eine konkrete Fähigkeit oder welches Wissen hätten Sie in Ihrer eigenen Schulzeit gebraucht, um heutige Umwelt- und Wirtschaftsentscheidungen besser verstehen und beurteilen zu können?
Vom „Wir“ zum Handeln
- Das „Wir“ in der Forderung „Wir müssen die Gesetze besser durchsetzen“ ist vage. Sehen Sie sich selbst in erster Linie als Wähler, Konsument, Aktivist, Berufstätiger in einem relevanten Feld oder in einer anderen Rolle, um diesen Wandel voranzubringen? Wo liegt Ihr größter Hebel?
- Wenn Umweltverbrechen wie Gewaltverbrechen behandelt werden sollen: Welche Analogien oder Unterschiede zwischen diesen Bereichen bereiten Ihnen persönlich Bauchschmerzen oder erscheinen Ihnen besonders treffend? (Z.B.: Sind „Ökozid“-Gesetze vergleichbar mit Mordanklagen? Ist Korruption in Umweltbehörden ähnlich gefährlich wie Polizeikorruption?)
Globale Verflechtung
- Der Text wirft die Frage nach globaler Gerechtigkeit auf: Kann ein strafrechtlicher Ansatz gegen „Green Crime“ gerecht sein, wenn die Macht- und Vermögensungleichheiten zwischen Ländern des globalen Nordens und Südens so massiv sind? Wo müsste „Gerechtigkeit“ hier ansetzen – bei der Bestrafung, beim Ausgleich oder woanders?
- Abschließend die Frage aus dem neuen Schluss: In Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld – wo haben Sie die konkrete Wahl, ob Sie „Fluch oder Segen“, d.h. Teil des Problems oder der Lösung sein wollen? Was würde es brauchen, um öfter die Wahl für den „Segen“ zu treffen?
Diese Fragen zielen darauf ab, die scheinbar klare Trennung zwischen „Täter“ und „unschuldiger Gesellschaft“ zu durchbrechen und die eigene Position in den komplexen Systemen, die Green Crime ermöglichen, zu reflektieren.