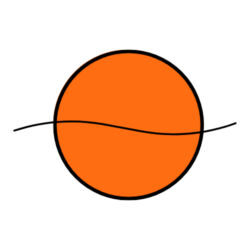Sie vermuten richtig: Das wird ein politischer Artikel. Und das ist verwunderlich, denn um dieses Thema mache ich üblicherweise einen großen Bogen. Ich habe überhaupt keine Lust, über Politik oder Demokratie zu schreiben, weil darüber wohl alles gesagt und geschrieben wurde, was gesagt werden muss. Viel lieber schreibe ich darüber, wie Menschen herausfinden, was sie gut können und gerne tun und damit persönlich wachsen, wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden und ihren Beitrag dazu leisten, unseren Planeten zu schützen. Aber wie soll man darüber schreiben, während das Fundament bereits von Wellen umspült wird und dem Gebäude der Einsturz droht?

Die Debatte darum, wer welcher Partei in Österreich bei der heuer anstehenden Nationalratswahl die Stimme geben wird, verursacht mir Bauchgrimmen und scheint eine Wahl des kleineren Übels zu werden. Denn wem wollte man noch sein Vertrauen schenken?
Das Hauptproblem der aktuellen Demokratien scheint der zunehmende Machtverlust der Bürger gegenüber der Staatsmacht zu sein. Die Menschen fühlen sich ausgeschlossen, betrogen und bestohlen. Umfragen zeigen, dass der überwiegende Teil der Öffentlichkeit in den westlichen Ländern Europas der Meinung ist, dass politische Parteien korrupt sind. Und damit haben wir ein weiteres schwerwiegendes Problem, denn es stellt sich zudem die Frage, wie viel Macht unsere Regierungen eigentlich noch haben.
Aber was soll man tun? Gar nicht mehr wählen gehen? Das Ansinnen ist durchaus verständlich und weshalb sollte man nicht auch das Recht haben politisch zu streiken? Das Problem lässt sich mit dieser Verweigerungshaltung allerdings nicht lösen.
Fragen und Zuhören – aber richtig
Es ist an der Zeit, neue Wege zu finden, um die Stimme des Volkes zu hören. Im Moment gibt es dafür vor allem Wahlen, Volksabstimmungen und Meinungsumfragen. Aber dort werden keineswegs die richtigen Fragen gestellt. Was nützt es, wenn man sich bei der Wahl eines Kandidaten zwischen Teufel und Beelzebub entscheiden oder bei einer Umfrage nur mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen kann?
Stellen Sie sich vor, es ist sechs Uhr abends, eine Mutter bereitet gerade das Abendessen für die Familie zu, die Kinder rufen nach Hilfe bei den Hausaufgaben, quengeln, weil sie lieber noch draußen spielen würden, der Vater ist geschafft von einem stressigen Arbeitstag und in diesem Moment klingelt das Telefon. Das Meinungsforschungsinstitut möchte, dass man sich unvorbereitet zu einem Thema äußert, von dem man meist ohnehin nicht viel weiß. „Was denken Sie über die Neuerungen in der Asylpolitik?“ „Äh, … keine Ahnung. Ich bin dagegen.“ Auf diese Weise werden tausende Personen befragt und die Ergebnisse fließen in die politischen Entscheidungen mit ein.
Viel interessanter, als zu wissen, was Menschen denken, wenn sie nicht denken, wäre, was sie zu sagen haben, wenn sie die Gelegenheit haben, sich mit dem Thema zu befassen. Das Instrument dafür könnte die Deliberative Demokratie sein. Bei diesem Verfahren werden Bürger zu einem Treffen mit Fachleuten eingeladen, um sich umfassend zu informieren, auszutauschen und zu diskutieren. Danach (und manchmal zum Vergleich auch davor) werden sie nach ihrer Meinung gefragt. Und diese Antworten sind wesentlich differenzierter und wohlüberlegt.
Gibt es das schon irgendwo? Ja, beispielsweise im Erdölstaat Texas, mit erstaunlichem Ausgang. Bei einer Fachtagung mit ausgelosten Bürgern wurde die Frage gestellt: „Würden Sie eine leicht erhöhte Stromrechnung in Kauf nehmen, damit erneuerbare Energien ausgebaut werden können?“ Wie zu erwarten, hatten wenige Leute Lust dazu. Während der Tagung, bei der es zahlreiche Informationen zu umweltfreundlichen Energien, Klimawandel, Umweltzerstörung, etc. gab, stieg die Zahl derer, die bereit waren etwas mehr zu zahlen, ständig. Heute ist Texas der amerikanische Bundesstaat mit den meisten Windrädern. Wie wäre die Entscheidung wohl gefallen, wäre diese Frage allein von den gewählten Politikern besprochen worden, die natürlich die Interessen der Erdölindustrie miteinbezogen hätten?
Wie könnte ein Ausblick in die Zukunft aussehen? Im Westen kennen wir die Demokratie schon seit 3000 Jahren, Wahlen hingegen erst seit 200 Jahren. Es gibt zahlreiche demokratische Traditionen, die schon vor den Wahlen bestanden. Vielleicht ist deren Zeit nun vorbei. Der Informationsfluss ist in rasantem Tempo gestiegen, ebenso wie die Zugänglichkeit. Damit ist zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit gegeben, die Bevölkerung auf ganz andere Weise zu Wort kommen zu lassen.
Repräsentativ durch das Zufallsprinzip
Eine Möglichkeit ist das Losverfahren, wie es von Schöffengerichten bekannt ist. Es garantiert uneingeschränkt die Norm der Gleichheit aller Teilnehmer. Alle Bürger, ob arm oder reich, weiblich oder männlich, jung oder alt, gesund oder krank, Unternehmer, Beamter oder Arbeiter hätten in der Demokratie die gleiche Chance, durch das Los gezogen zu werden. Kein Teilnehmer könne über eigenes ökonomisches, soziales oder kulturelles Kapital seine Chancen erhöhen, sich Vorteile gegenüber anderen verschaffen und den Ausgang beeinflussen. Natürlich ist das System nicht perfekt, aber die Schöffen nehmen im Allgemeinen ihre Aufgabe sehr ernst und machen sich kundig, ehe sie eine Entscheidung treffen, die sowohl der Justiz als auch der Gesellschaft gerecht wird. Kombiniert man das Losverfahren mit der Deliberativen Demokratie, kommen wesentlich bessere Entscheidungen zustande, als unsere gewählten Parteien sie zu treffen imstande sind.
Ein Beispiel: In Irland wurde 2014 ein Verfassungskonvent veranstaltet. Ein Gelegenheitsparlament, bestehend aus 33 irischen Abgeordneten und 66 ausgelosten Durchschnittsbürgern sowie einem Vorsitzenden beriet sich 14 Monate lang über acht Artikel der irischen Verfassung. Die Diskussionen wurden im Internet übertragen und die Bevölkerung war aufgerufen, sich zu beteiligen und ihre Beiträge zu schicken. Eines der überraschenden Ergebnisse: Im erzkatholischen Irland wurde offiziell empfohlen, den Verfassungsartikel zu ändern, um eine gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren.
Die isländische Revolution von 2008 war eine beispiellose Bewegung, die aus der globalen Finanzkrise heraus entstand und eine einzigartige Kombination aus Bürgerprotesten, politischem Wandel und dem Einsatz neuer Technologien zur politischen Partizipation darstellte.
Eine der innovativsten Maßnahmen, die während dieser Zeit ergriffen wurden, war die Entscheidung, eine neue Verfassung zu erstellen – eine, die nicht von Politikern oder Experten, sondern von den Bürgern selbst entwickelt wurde. Um dies zu erreichen, nutzte Island Crowdsourcing-Techniken, um Ideen und Vorschläge von Tausenden von Bürgern zu sammeln. Durch Online-Plattformen und öffentliche Versammlungen hatten die Isländer die Möglichkeit, direkt an der Gestaltung ihrer Verfassung teilzunehmen.
Doch wo soll man anfangen? Müssten Maßnahmen wie die Einführung eines Losverfahrens oder einer Deliberativen Demokratie nicht von der politischen Führung selbst in Gang gesetzt werden? Ist die Regierung überhaupt daran interessiert, dass das System sich ändert? Und falls ja, wäre sie in der Lage, das zu tun, entgegen der Interessen von Wirtschaft und Finanz, im Würgegriff der kommerziellen und sozialen Medien?
Dabei wäre Demokratie doch ganz simpel: Bürger setzen sich zusammen, fragen sich, was es für ein gutes Leben braucht und treffen gemeinsam Entscheidungen für die Zukunft der Gesellschaft. Das nennt sich dann übrigens Dialog.

Mündig werden. Sein Schicksal in die Hand nehmen.
Mit zunehmender Kluft zwischen arm und reich wird es mehr und mehr Bürger geben, die „Nein“ sagen, etwa dadurch, dass sie bewusst nicht mehr wählen. Gleichzeitig gibt es jedoch auch Gruppen, die beginnen, sich selbst zu organisieren, um für demokratische Rechte zu sensibilisieren, neue Regeln für die Gemeinschaft ausarbeiten und anstatt sauer zu sein und zu kritisieren, selbst den Wandel herbeiführen, den sie sich wünschen. Man denke etwa an die verfassungsgebenden Werkstätten oder die kunterbunten Graswurzelbewegungen. Was wir brauchen ist eine Koalition von Menschen guten Willens, sowohl in der Bevölkerung, als auch in der Politik und der Wirtschaft.
Und damit erreichen Gemeinden und Städte einen ganz neuen Stellenwert in der Demokratie als treibende Kräfte. Demokratien haben sich immer schon vom Lokalen zum Globalen entwickelt und dies könnte eine Zeit der Renaissance sein. In Athen hätte wohl kaum jemand geglaubt, dass es eines Tages Demokratien mit einer Milliarde Menschen wie in Indien geben würde.
In Kuttambakkam, einem kleinen Dorf im Bundesstaat Tamil Nadu in Südindien, wurde die bemerkenswerte Geschichte eines selbstverwalteten Dorfes geschrieben. Diese Geschichte zeigt, wie die Bewohner eines Dorfes sich zusammenschließen können, um ihre Gemeinschaft selbst zu regieren, ohne auf externe politische Strukturen angewiesen zu sein.
Die Bewohner von Kuttambakkam wurden lange Zeit von landwirtschaftlichen Problemen, Armut, Müll, Analphabethentum und mangelnder Infrastruktur geplagt. In den späten 1990er Jahren beschlossen sie jedoch, sich dieser Herausforderungen gemeinsam zu stellen und eine neue Form der Selbstverwaltung zu schaffen.
Die Dorfbewohner organisierten sich in Selbsthilfegruppen und begannen, lokale Ressourcen zu nutzen, um die Lebensbedingungen im Dorf zu verbessern. Sie bauten Straßen, Schulen und Brunnen, starteten Programme zur Förderung der Landwirtschaft und verbesserten die Gesundheitsversorgung. Diese Bemühungen waren weitgehend von den Dorfbewohnern selbst finanziert und durchgeführt, wobei sie auf traditionelle Wissenssysteme und kollektive Entscheidungsfindung zurückgriffen.
Ein entscheidender Moment in der Geschichte von Kuttambakkam war die Einführung des Konzepts der Gram Sabhas, lokaler Versammlungen, in denen alle Dorfbewohner zusammenkommen, um über Angelegenheiten zu diskutieren, die ihr Dorf betreffen, und um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Diese Gram Sabhas wurden zu einem wichtigen Forum für die demokratische Teilhabe der Dorfbewohner und ermöglichten es ihnen, ihre Stimme in lokalen Angelegenheiten zu erheben und ihre eigenen Prioritäten zu setzen.
Durch ihre kollektiven Anstrengungen und ihre Beteiligung an der Selbstverwaltung konnten die Bewohner von Kuttambakkam eine nachhaltige Entwicklung in ihrem Dorf fördern und eine starke Gemeinschaft aufbauen, die auf Solidarität und gegenseitiger Unterstützung basiert. Ihre Geschichte zeigt, wie die Ideale der Selbstverwaltung und der lokalen Demokratie verwirklicht werden können, wenn die Bürger sich aktiv für ihre Gemeinschaft einsetzen und gemeinsam an Lösungen arbeiten.
Texas. Irland. Island. Indien. Sie haben natürlich recht. Das ist alles so weit weg. Deshalb zuletzt noch ein Beispiel aus unmittelbarer Nähe, nämlich die umtriebige Stadt Lindau, in der ich letzte Woche bei einer Projektschmiede mitdenken durfte. Seit 2018 sind dort etliche Projekte der Bürgerbeteiligung entstanden, die hier dokumentiert sind.
Die stille Revolution
Vielleicht ist das, was gerade auf der ganzen Welt passiert, eine stille Revolution. Millionen von Menschen warten nicht mehr auf eine Genehmigung von oben, sondern krempeln die Ärmel hoch und machen sich an die Arbeit. Gemeinschaftsgärten entstehen, alternative Energiesysteme werden im Selbstbau erstellt, das Schulsystem reformiert, Komplementärwährungen eingeführt, es wird repariert, recycelt, selber gemacht.
Das Problem ist nicht, dass wir die Lösungen für die Probleme im Kleinen und Großen nicht kennen würden. Die Schwierigkeit ist, die Bevölkerung in größerem Umfang zu inspieren und zu motivieren, aktiv zu werden und die Sache in Angriff zu nehmen. Und das bedeutet auch, dass wir wieder lernen müssen zusammen zu arbeiten. Es gibt viele Gruppen von Aktivisten, die sich irgendwann zerstritten haben. Das ermüdet und bringt uns nicht dahin, wo wir hinwollen. Der Wandel erfordert gemeinsame Visionen, Mut etwas zu riskieren, Neues auszuprobieren, einander zu unterstützen, kreativ zu sein, eine lebenswerte Zukunft zu erträumen und miteinander zu feiern. Dragon Dreaming ist (mehr als) eine Methodensammlung, die diese Kompetenzen pflegt und würdigt und dabei lebendige, beflügelnde Projekte entstehen lässt.

Für oder gegen?
Es gibt zwei Arten, seiner Politikverdrossenheit Luft zu machen. Man kann viel Zeit und Energie einsetzen, um zu kritisieren und Kampagnen zu organisieren, die vielleicht irgendwann mehr oder weniger dazu führen, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden.
Oder man könnte sagen, wie Rob Hopkins es ausdrückt: „Macht doch einfach was ihr wollt. Aber seid euch darüber im Klaren, dass es überall auf der Welt Leute gibt, die anfangen so zu leben, wie es für ein gutes Leben für alle notwendig ist. Und während sie das tun, knüpfen sie Freundschaften, haben Spass, gründen Unternehmen, essen gut, trinken selbstgebrautes Bier, zahlen für ihren Strom weniger und fühlen sich als Teil einer historischen Bewegung. Ihr könnt euch dafür einsetzen diesen Prozess zu unterstützen, aber macht einfach was ihr wollt, denn es passiert mit oder ohne euch. Es ist eine stille Revolution. Und wenn euer Herz es befiehlt: Dann macht doch einfach mit.“
(Dieser Artikel ist übrigens inspiriert von einem Kinobesuch am Spielboden entstanden. Schon der Auftakt zum Film war bemerkenswert, denn die beiden Mitorganisatoren haben ganz unterschiedliche Ansätze, die Welt zu verändern: die einen protestierend, die anderen unterstützend. Grund genug einander in die Haare zu geraten. Aber statt dessen gab es eine wertschätzende Vorstellung der beiden Ansätze. Sowohl der Film wie auch das Buch zum Film sind in der Vorarlberger Landesbibliothek entlehnbar.)
Literatur
- Dion, C., Müller, E., J. Kamphausen Mediengruppe GmbH, & Xa-De-Nw. (2017). Tomorrow : die Welt ist voller Lösungen (1. Auflage).
- Laurent, M., Barnosky, A., & Dion, C. (2016). Tomorrow : die Welt ist voller Lösungen. DVD.
- List, Christian & Sliwka, Anne. (2004). »Deliberative Polling« als Methode zum Erlernen des demokratischen Sprechens. ZfP. 10.5771/0044-3360-2004-1-87.
- Reybrouck, D. van, & Braun, A. (2016). Gegen Wahlen : warum Abstimmen nicht demokratisch ist (1. Auflage).