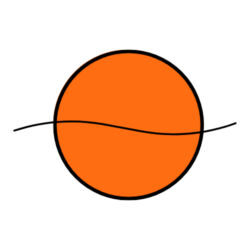In unserer durchgetakteten, leistungsgetriebenen Welt scheint eine tiefe Leerstelle zu klaffen – die der Beziehung. Nicht nur zu anderen Menschen, sondern zu allem Lebendigen. Was uns fehlt, ist nicht mehr Wissen, nicht mehr Technik, nicht einmal mehr gute Absichten. Was uns fehlt, ist Gegenseitigkeit.
Unsere westlich geprägte Lebensweise basiert auf Trennung: Mensch und Natur, Subjekt und Objekt, Nutzen und Aufwand. In dieser Denkweise ist der Mensch nicht Teil eines lebendigen Ganzen, sondern dessen selbsternannter Herrscher. Die Welt wird zur Ressource, zum Objekt der Nutzung, zur Bühne für menschliche Selbstverwirklichung. Wir fragen selten, was das Leben selbst braucht – sondern was wir ihm entreißen können.
Doch die Folgen dieser Entfremdung sind unübersehbar geworden. Nicht nur ökologisch, auch seelisch leben wir in einer Krise. Die kollektive Erschöpfung, die viele Menschen heute empfinden, ist auch eine Resonanz auf den Ausschluss des Fühlens aus unserem Weltzugang. Denn die Welt – das Leben – ist nicht ein mechanisches System aus Dingen. Sie ist ein Gewebe aus Beziehungen.
Die Wiederentdeckung der Empfindung
Die Fähigkeit, sich einzufühlen in andere Lebewesen, wurde in der Moderne lange als irrational, sentimental oder gar hinderlich abgetan. Dabei ist sie ein zentrales Organ unserer Menschlichkeit – und unserer ökologischen Intelligenz. Wir spüren, wenn etwas falsch läuft, lange bevor wir es messen können. Dieses Wissen, das aus dem Mitsein entsteht, wurde verdrängt. Es wurde kolonialisiert – nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Unsere Seelen wurden gezwungen, sich einem Weltbild zu unterwerfen, das Beziehungslosigkeit als Objektivität tarnt.
Doch in Wirklichkeit ist nichts neutral. Auch das „Beobachten“ ist ein Akt der Beziehung – oder ihrer Verweigerung. Die sogenannte Natur, von der wir sprechen, ist keine Außenwelt. Sie ist das lebendige Ganze, in dem wir immer schon enthalten sind. Wir atmen nicht in der Natur. Wir sind Natur, atmend.

Indigenialität – Lernen von lebendigen Kulturen
In vielen indigenen Kulturen existiert kein Begriff für „Natur“, weil die Trennung, die dieser Begriff impliziert, schlicht keinen Sinn macht. Dort ist das Leben durchdrungen von dem Wissen, dass alles miteinander verbunden ist – durch Austausch, durch Resonanz, durch wechselseitige Verantwortung. Diese Haltung ist keine Nostalgie, kein romantischer Rückfall in vormoderne Zustände. Sie ist ein radikaler Realismus, der die Lebendigkeit der Welt ernst nimmt.
Was wir brauchen, ist keine Rückkehr zur Vergangenheit. Wir brauchen eine Zukunft, die aus der Erinnerung an unsere Beziehungsfähigkeit geboren wird. Eine neue Lebenskunst, die Andreas Weber „Indigenialität“ nennt – eine geniale, dem Leben zugewandte Haltung, die sich an indigener Weisheit inspiriert, ohne sie zu vereinnahmen.
Indigenialität bedeutet: zu fühlen, bevor man handelt. Zu fragen: Was braucht das Leben in mir? Was braucht das Leben um mich? Und zu begreifen, dass es auf diese Fragen keine getrennten Antworten geben kann.
Der Kosmos als Mitbewohner
Wenn wir den Planeten nicht mehr als Hintergrund für menschliches Handeln betrachten, sondern als lebendigen Mitbewohner, entsteht ein anderer Ethos. Dann wird das „ökologische Problem“ nicht zu einem technischen Projekt, sondern zu einer Frage des Mitgefühls. Dann reicht es nicht mehr, CO₂ zu reduzieren. Dann wollen wir fühlen, wie es den Bäumen, den Vögeln, den Böden, den Meeren, den Mikroben geht – und handeln in diesem Wissen.
Dieses Handeln beginnt nicht auf globalen Klimakonferenzen. Es beginnt im Alltag: beim Essen, beim Blick auf das Tier im Stall, bei der Entscheidung, wie viel wir wirklich brauchen, und bei der Frage, ob unser inneres Tempo noch mit dem Atem des Lebendigen in Einklang ist.
Zurück in die Beziehung
In einer Zeit, in der wir alles über „die Natur“ zu wissen glauben, ist es vielleicht das Wichtigste, wieder zu lernen, wie man sie liebt. Nicht sentimental, sondern wirklich: mit wacher Wahrnehmung, mit Bereitschaft zur Verantwortung, mit der Demut, dass wir nicht über, sondern mit ihr leben.
Gegenseitigkeit ist keine Utopie. Sie ist ein Grundprinzip des Lebendigen. Wo sie gelebt wird, entsteht nicht nur ökologische Stabilität – es entsteht Sinn. Und vielleicht ist das das größte Geschenk, das eine neue Lebenskunst uns machen kann: den Sinn nicht in der Wirkung zu suchen, sondern in der Verbindung.
Reflexionsfragen für eine Lebenskunst in Verbundenheit
- Wem oder was bin ich heute wirklich begegnet – mit offenem Herzen, nicht nur mit den Augen?
- Was fließt mir täglich zu – ohne dass ich darum bitten muss? Und was fließt von mir zurück?
- Wo nehme ich – ohne zu geben? Und wo entsteht ein leises Gleichgewicht?
- Wann hat mein Inneres zuletzt aufgeatmet – und was könnte ich tun, damit es wieder geschieht?
- Welche Stimme in mir wurde überhört – und was flüstert sie mir jetzt, wo ich still bin?
- Will ich Teil des Spiels sein – oder bleibe ich Zuschauer am Rand des Lebendigen?
Literatur
- Weber, A. (2023). Indigenialität: Leben als Beziehung. Berlin: Nicolai.
- Kimmerer, R. W. (2021). Geflochtenes Süßgras: Die Weisheit der Pflanzen und die Lehren der indigenen Völker. München: Ludwig Verlag.
- Abram, D. (2011). Im Bann der sinnlichen Welt: Die Sprache der Natur und das Abenteuer der Wahrnehmung. Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen.
- Macy, J., & Johnstone, C. (2013). Hoffnung durch Handeln: Wie wir trotz globaler Krisen kraftvoll leben können. Bielefeld: J. Kamphausen.
- Eisenstein, C. (2014). Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. München: Arkana.