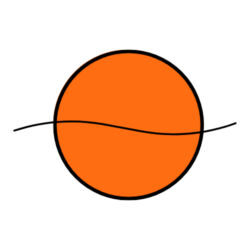Viele Menschen erleben aktuell eine Zeit tiefgreifender Spannungen – gesellschaftlich, politisch, ökologisch. Es fühlt sich an, als steuere eine komplexe Welt in Zeitlupe auf einen Zusammenstoß zu.
Lange gab es noch die Hoffnung, gegensteuern zu können. Doch inzwischen wirkt es, als würde das Tempo zunehmen, nicht abnehmen. Ein Ereignis, das sich lange angekündigt hat, scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein.
Gleichzeitig birgt dieser Moment auch eine Möglichkeit: Wenn die Erschütterung groß genug ist, stellt sich eine zentrale Frage neu:
Was können wir – einzeln und gemeinsam – aus dem Entstandenen machen?
Es braucht die Bereitschaft, vertraute Denkmuster zu hinterfragen – auch dann, wenn das Unbehagen dabei groß ist.

Prophezeiung oder Vorhersage: Der Unterschied zählt
Immer wieder tauchen Aussagen über kommende Wendepunkte auf: Jahre wie 2012, 2028 oder andere symbolische Daten stehen für den Wunsch nach Neuanfang.
Dabei handelt es sich nicht um festgelegte Vorhersagen, sondern um sogenannte Prophezeiungen. Der Unterschied ist wesentlich:
- Vorhersagen deuten auf ein festgelegtes Ereignis, das unabhängig vom menschlichen Handeln eintritt.
- Prophezeiungen zeigen Möglichkeiten auf – sie werden nur dann Wirklichkeit, wenn Menschen sich innerlich darauf ausrichten und entsprechend handeln.
Der Glaube, dass ein Zusammenbruch automatisch zu Veränderung führt, hat sich oft als trügerisch erwiesen. Wie bei individuellen Krisen oder Suchterfahrungen gilt: Veränderung beginnt mit der bewussten Entscheidung für einen neuen Weg.
Die Kriegsmentalität als kollektive Gewohnheit
Eine der zentralen Dynamiken unserer Zeit ist die Verhaftung in einer sogenannten Kriegsmentalität – ein Denken, das auf Gegnerschaft basiert.
Dabei handelt es sich nicht primär um offene Gewalt, sondern um ein tief verinnerlichtes Muster:
- Die Welt wird in Gegensätze eingeteilt: Wir gegen Die, Gut gegen Böse.
- Probleme werden in Kategorien von Sieg oder Niederlage gedacht.
- Schuldzuweisungen ersetzen Verständigung und gemeinsame Lösungsfindung.
Dieses Denken kann zur kollektiven Gewohnheit werden – einer Art mentaler Sucht. Und wie bei jeder Sucht gilt: Je weniger eine Strategie funktioniert, desto stärker wird sie wiederholt.
Beispiele aus Gesellschaft und Alltag
Kriegsmentalität begegnet uns in vielen Lebensbereichen:
- Medizin: Der Fokus liegt häufig auf dem „Kampf gegen Krankheit“, statt auf Stärkung von Gesundheit und Resilienz.
- Landwirtschaft: „Unkrautvernichtung“ statt Förderung eines lebendigen Ökosystems.
- Politik: Das Ziel scheint oft, den politischen Gegner zu besiegen, statt tragfähige Lösungen im Dialog zu entwickeln.
Die Reaktionen auf die Pandemie spiegelten diese Kriegsmentalität wider: Ein klar definierter Feind (das Virus) erlaubte kollektive Projektionen und führte zu Maßnahmen, die von übervorsichtig bis autoritär reichten.
Verschwörungserzählungen als Ausdruck des gleichen Musters
Verschwörungserzählungen entstehen oft aus einem Bedürfnis nach Kontrolle und Erklärbarkeit. Auch sie greifen auf dasselbe Muster zurück:
- Eine klar abgegrenzte Gruppe wird für alles verantwortlich gemacht.
- Die Lösung scheint einfach: „Wenn die weg sind, ist alles wieder gut.“
Doch das eigentliche Problem liegt tiefer – in einem kollektiven Denken, das Spaltung statt Verbindung fördert.

Polarisierung und Eskalation: Wenn Gegnerschaft zum Selbstzweck wird
In vielen Gesellschaften – sichtbar etwa in den USA – nehmen Polarisierung und Gegnerschaft zu.
- Die jeweiligen politischen Lager sehen sich nicht mehr nur als Konkurrenten, sondern als Bedrohung.
- Das führt zu einem Teufelskreis: Jede Seite rechtfertigt eigene Überschreitungen mit der vermeintlichen Gefährlichkeit der anderen.
Was als Schutz der Demokratie beginnt, kann so in autoritäre Tendenzen münden – auf beiden Seiten.
Globale Abhängigkeit statt Wirtschaftskrieg
Auch wirtschaftliche Strategien zeigen die Wirkung der Kriegslogik:
- Maßnahmen wie Strafzölle wirken kurzfristig wie Stärke, führen aber oft zu neuen Abhängigkeiten und Unsicherheiten.
- In einer global vernetzten Welt schadet Eskalation häufig beiden Seiten.
Ein Umdenken hin zu Kooperation, Resilienz und gegenseitigem Verständnis wäre hier nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll.
Die Chance im Umbruch: Was kann entstehen?
Krisen bringen oft Klarheit:
- Krieg schafft keinen Frieden.
- Hass führt nicht zu Gerechtigkeit.
- Kontrolle bietet keine echte Sicherheit.
Doch die entscheidende Frage ist: Wie gehen wir mit dieser Erkenntnis um?
- Kehren wir zurück in bekannte Muster?
- Oder nutzen wir die Gelegenheit, neue Formen des Miteinanders zu entwickeln – auch wenn sie noch ungewohnt oder unsicher erscheinen?
„Warte ab“ – eine Haltung der Reife
In manchen Weisheitstraditionen wird empfohlen, „abzuwarten“. Damit ist nicht gemeint, nichts zu tun – sondern achtsam zu handeln:
- Nicht aus Angst oder Impulsivität heraus, sondern mit Blick auf das größere Ganze.
- Nicht jedes Drama muss sofort beantwortet werden – manche dürfen sich vollenden, bevor etwas Neues entstehen kann.
Diese Haltung erfordert Geduld, Vertrauen – und oft auch den Mut, das eigene Weltbild zu hinterfragen.
Wege aus der kollektiven Sucht
Kriegsmentalität ist kein individuelles Problem – sondern Ausdruck eines kollektiven Musters.
Doch wie bei jeder Abhängigkeit gibt es einen Wendepunkt:
- Weiter in der bekannten Dynamik verharren.
- Oder: Innehalten, reflektieren und sich bewusst für eine neue Richtung entscheiden.
Inmitten der Erschütterung liegt die Möglichkeit, etwas grundlegend Neues zu gestalten:
Eine Kultur jenseits von Spaltung – geprägt von Verbundenheit, Verantwortung und gemeinsamer Gestaltungskraft.
Die Frage lautet nicht, ob das möglich ist. Sondern:
Sind wir bereit, diese Möglichkeit zu ergreifen?
Reflexionsfragen:
Diese Fragen laden dazu ein, den Text auf das eigene Leben und das gesellschaftliche Miteinander zu beziehen – allein oder im Austausch mit anderen:
- Wo begegnet mir in meinem Alltag Kriegsmentalität, ein Wir-gegen-Die-Denken – bewusst oder unbewusst?
- In welchen Bereichen reagiere ich selbst mit „Kampfmodus“ – und was wären Alternativen?
- Welche Erfahrungen habe ich mit Kooperation in Konflikten gemacht – was hat geholfen?
- Welche gesellschaftlichen Narrative empfinde ich als polarisierend – und wie könnte ich ihnen anders begegnen?
- Wie gehe ich mit Unsicherheit um – habe ich Strategien, mit ihr präsent zu bleiben, statt in Aktionismus zu verfallen?
- Was bedeutet es für mich, „innezuhalten“? Wo könnte das aktuell hilfreich sein?
Literatur
Assmann, A. (2021). Die Wiedererfindung der Nation: Warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen. C.H. Beck.
Eisenstein, C. (2014). Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Neue Erde.
Glasl, F. (2011). Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater (10. Aufl.). Freies Geistesleben.
Graeber, D., & Wengrow, D. (2022). Anfänge: Eine neue Geschichte der Menschheit. Klett-Cotta.
Hübl, T. (2022). Bewusstseinsarbeit in Zeiten von Krisen: Wege zur Heilung kollektiver Traumata. Arkana.
Illich, I. (1975). Die Nemesis der Medizin: Die Kritik der Medikalisierung des Lebens. C.H. Beck.
Joas, H. (2012). Die Sakralität der Person: Eine neue Genealogie der Menschenrechte. Suhrkamp.
Krieg, G. (2020). Wir gegen die: Die Psychologie der Feindbilder. Freiburg: Herder.
Rosa, H. (2016). Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp.
Scharmer, O. C. (2019). Theorie U: Von der Zukunft her führen (5. Aufl.). Campus.
Sloterdijk, P. (2006). Zorn und Zeit: Politisch-psychologischer Versuch. Suhrkamp.
Watzlawick, P., Weakland, J. H., & Fisch, R. (2011). Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels (16. Aufl.). Huber.