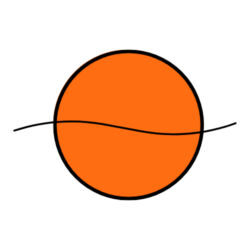Wer den langen Weg der Solidarität bis heute verfolgt, kann sich ob der widersprüchlichen Verwendung während der Coronakrise nur verblüfft zeigen. Der kämpferische Begriff der Arbeiterbewegung ist ins Zentrum staatlicher Krisenpolitik verschoben worden und mit ihm die Zahl der positiv Getesteten als Maßzahl solidarischen Handelns.
Verband man früher Solidarität mit dem Drang zur Umgestaltung untragbarer Zustände, mutierte sie in Coronazeiten zum Abbild des staatsbürgerlichen Gehorsams in Form von Befolgen der von der Exekutive auferlegten Regeln. Der achtsame Nachbar von nebenan, der die Einhaltung dieser Regeln überwachte, konnte sich so als Vorbild gesellschaftlicher Solidarität profilieren. Das zur Bewältigung der Pandemie notwendige Social Distancing erstickte den Samen solidarischen Handelns im Keim: das Zusammenkommen und sich Austauschen.
Die Aufforderung mancher Virologen, jeden Mitmenschen a priori als potenziellen Virenträger und damit als Bedrohung anzusehen, kann in der ihr eigenen Logik durchaus vernünftig scheinen. Doch steht ein solcher Entwurf einer Gesellschaft im krassen und unüberbrückbaren Gegensatz zu dem, was bislang als Solidarität galt.
Die allgegenwärtige Forderung nach Solidarität gibt Auskunft darüber, wer denn eigentlich in hohem Maße geschützt werden soll, und wessen Leid hingegen keiner Erwähnung bedarf. Und das sind – wie schon vor der Coronakrise – die sozial Schwächsten: Alleinerziehende Eltern, Migranten, Obdachlose, alte Menschen – mit geringer Rente oder gar pflegebedürftig.
Was ist sie nun, diese Solidarität? Ist sie schon da, wenn wir als Steuerzahler den Solidarbeitrag leisten oder Klimaproteste auf Twitter liken? Bin ich unsolidarisch, wenn ich an einem Bettler vorübergehe und solidarisch, wenn ich für „Brot für die Welt“ spende? Denke ich unsolidarisch, wenn ich mich als finanziell erheblich belasteter junger Berufstätiger ärgere, in eine Pensionskasse einzuzahlen, die mir selbst möglicherweise nie zugutekommen wird? Bin ich solidarisch auf Kosten anderer, wenn ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen eintrete?
Oder müssen wir an die persönliche Komfortzone heran? Gleich heute, wenn wir beschließen das Auto stehenzulassen, dann aber bemerken, dass man mit den Öffis nicht rechtzeitig zur Arbeit kommt. Oder wenn die Kinder meckern, dass es statt der Banane heute schon etwas mehlige Äpfel zum Pausenbrot gibt? Der Blick in den Kleiderschrank lässt gleich wieder die Stirn runzeln: Ist das alles umweltverträglich und menschenwürdig hergestellt worden? Und brauche ich das wirklich alles? Zumindest bietet sich die Pause dazu an, mit den Arbeitskollegen zu diskutieren, weshalb es gescheiter wäre Fair Trade Kaffee zu trinken. Mit dem Chef über ein Vier-Stunden-Arbeitsmodell zu reden, wäre wohl noch zu früh und möglicherweise jobgefährdend. Aber wenigstens könnte man den geplanten Urlaub in Mallorca gegen die Ostsee tauschen. Die Bahnfahrt wäre zwar teurer, aber die Klimabilanz vermutlich besser …
Diese Beispiele lassen erahnen, dass Solidarität nicht nur der Überbegriff für Freundlichkeit, Mitgefühl und sozialstaatliche Folgebereitschaft sein kann. Sie berührt unser Verständnis von Zugehörigkeit, die Bereitschaft, sich den Nöten der Mitmenschen zu stellen und das Gefühl der Verantwortung und Fürsorge für das Ganze. Wer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, die anderen ihrem Schicksal überlässt, wem die Gemeinschaft und unser Planet gleichgültig ist, der pfeift auf Solidarität.
Katastrophen und Krisen können das Beste im Menschen zum Vorschein bringen, so Rebecca Solnit in ihrem Buch „A paradise built in hell“. Der natürliche Zustand, zu dem wir zurückgreifen, wenn die gewohnten Strukturen nicht mehr tragen, ist nicht jeder gegen jeden. Zahlreiche Belege dafür findet sie in den Katastrophen der letzten hundert Jahre: Erdbeben, Wirbelstürme, Bombenangriffe, Terroranschläge oder auch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl.
In Katastrophen brechen Hierarchien auf. Verwaltung und Institutionen wirken nicht mehr. Es entsteht aber eine Selbstorganisation, um Chaos zu verhindern. Es werden Suppenküchen gebaut, Notunterkünfte errichtet, Kinder betreut. Dabei verhält sich die Mehrzahl der Menschen ruhig, einfallsreich und ganz und gar nicht egoistisch.
Das ist aber nur ein Blickwinkel. Es gibt durchaus auch Beispiele dafür, dass eine Bedrohung von außen die Bevölkerung dazu bringen kann, nach Sündenböcken zu suchen: Etwa, als die Juden bezichtigt wurden, für die Pest verantwortlich zu sein. Es gibt allerdings auch Hinweise, dass Krisen dann zu Diskriminierung führen, wenn die Politik dies beabsichtigt. Während die Schuld Außenstehenden in die Schuhe geschoben wird, können die wirklich Verantwortlichen ungeschoren davon kommen.
Krisen, die uns wie aus dem Nichts treffen, erinnern uns daran, dass wir alle im selben Boot sitzen. Die Verdrängungsmechanismen, die uns im Alltag das Elend rund um uns herum ertragen lassen, brechen weg und wir identifizieren uns mit den Betroffenen. Wir spüren die menschliche Verwundbarkeit und unser Verantwortungsgefühl aktiviert die Solidarität.
Die Frage, die sich stellt: Kann diese Solidarität Bestand haben, wenn die Krise vorbei ist?
In den westlichen Gesellschaften haben wir uns über lange Zeit das Recht erworben, uns selbst zu definieren. Freiheit bedeutet aber auch die gar nicht leichte Aufgabe, zu bestimmen, welche Rolle man in dieser Welt einnehmen möchte. Aber wie wir es auch drehen und wenden, wir sind abhängig voneinander. Unsere Freiheit hängt untrennbar von der Freiheit der anderen ab. Und spätestens wenn ein bedrohlicher Virus erscheint, ist es entscheidend, darauf vertrauen zu können, dass jeder tut, was er kann inklusive der dafür beauftragten Institutionen.
Hat es die Corona-Krise gebraucht, um das zu erkennen? Das wäre ein gefährlicher Trugschluss. Die positive Folge könnte aber sein, dass wir uns der Werkzeuge besinnen, mittels derer wir eine freie, sichere Gesellschaft aufbauen können, die der solidarischen Natur des Menschen entspricht.
Der Schlüssel dazu, der alle Türen öffnet, ist der Dialog.
Literatur:
- Bude, H.: Solidarität. Die Zukunft einer großen Idee. München, 2019.
- I.L.A. Kollektiv: Das gute Leben für Alle. Wege in die solidarische Lebensweise. München, 2019.
- Harsvik, W. & Skjerve, I.: Homo Solidaricus. Der Mensch ist besser als sein Ruf. Berlin, 2021.
- Solnit, R.: A paradise built in hell. New York, 2009.
- Süss, D. & Torp, C.: Solidarität. Vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Bonn, 2021.
- wer keine Fachbücher mag, dem sei folgender Roman empfohlen: Ironmonger, J.: Der Wal und das Ende der Welt. Frankfurt, 2020.
Dieser Artikel ist unter einer Creative Commons–Lizenz (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International) lizenziert.