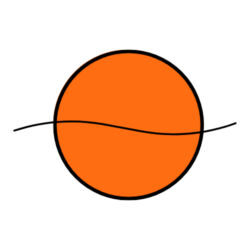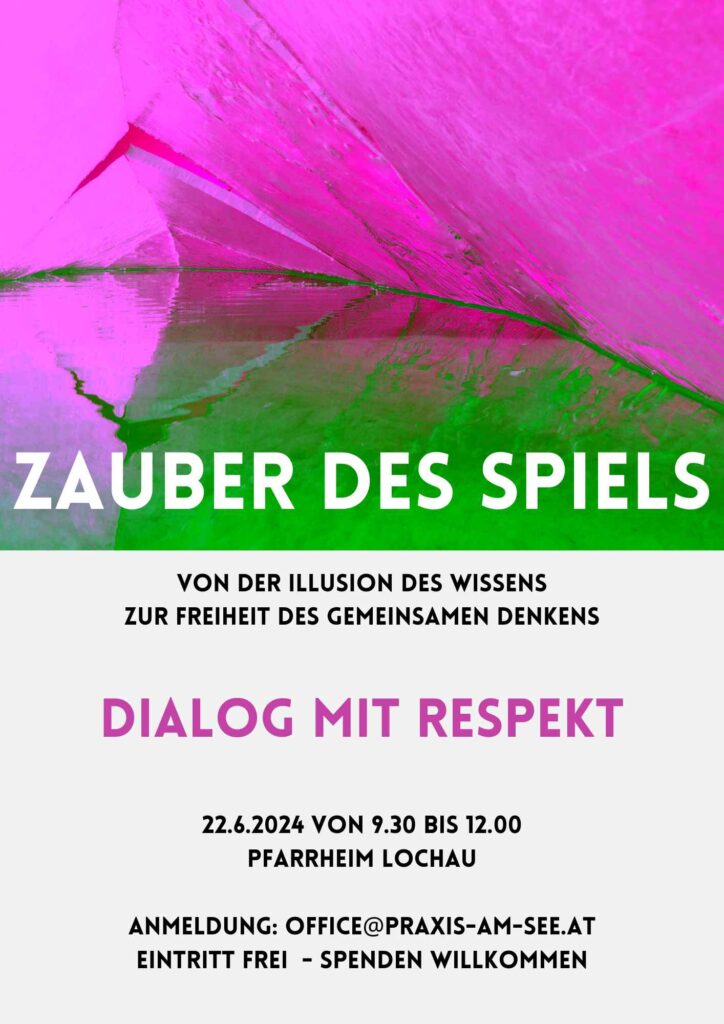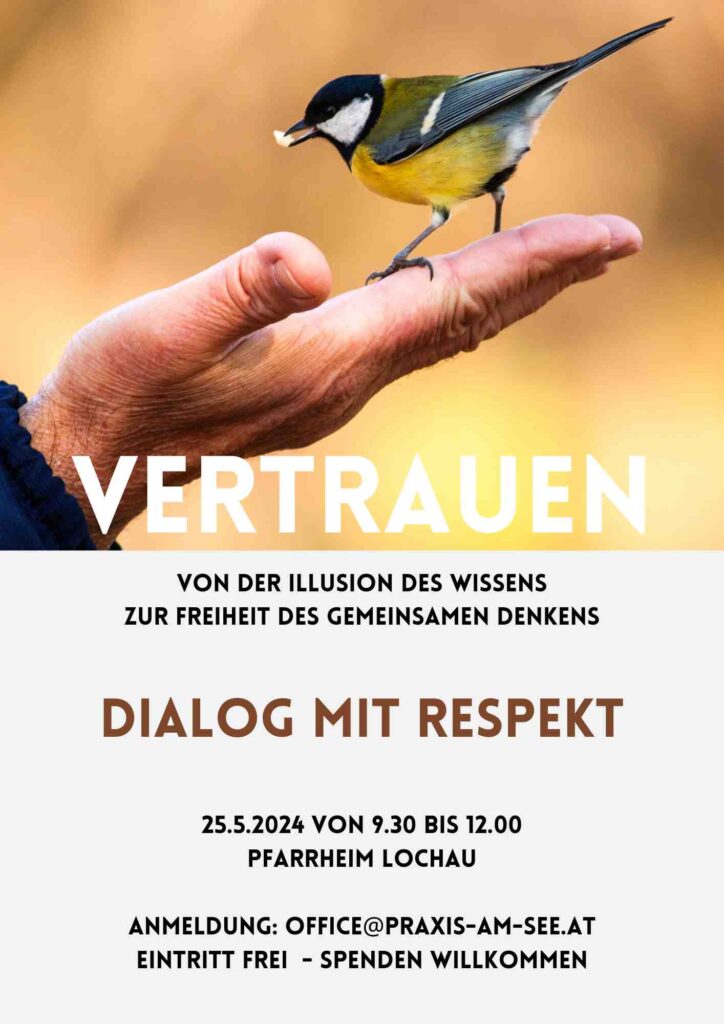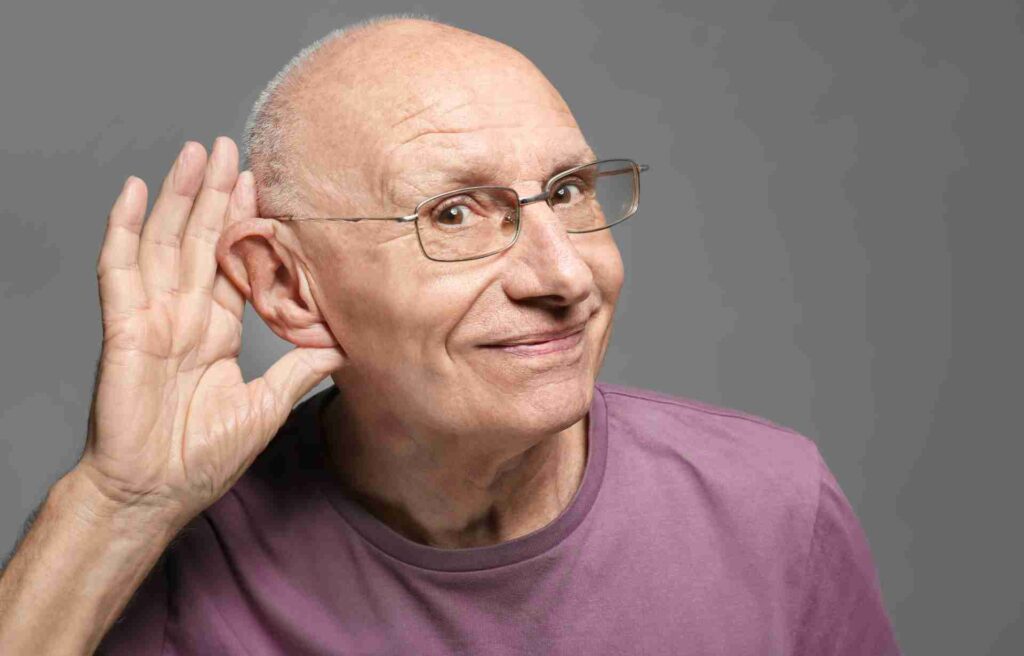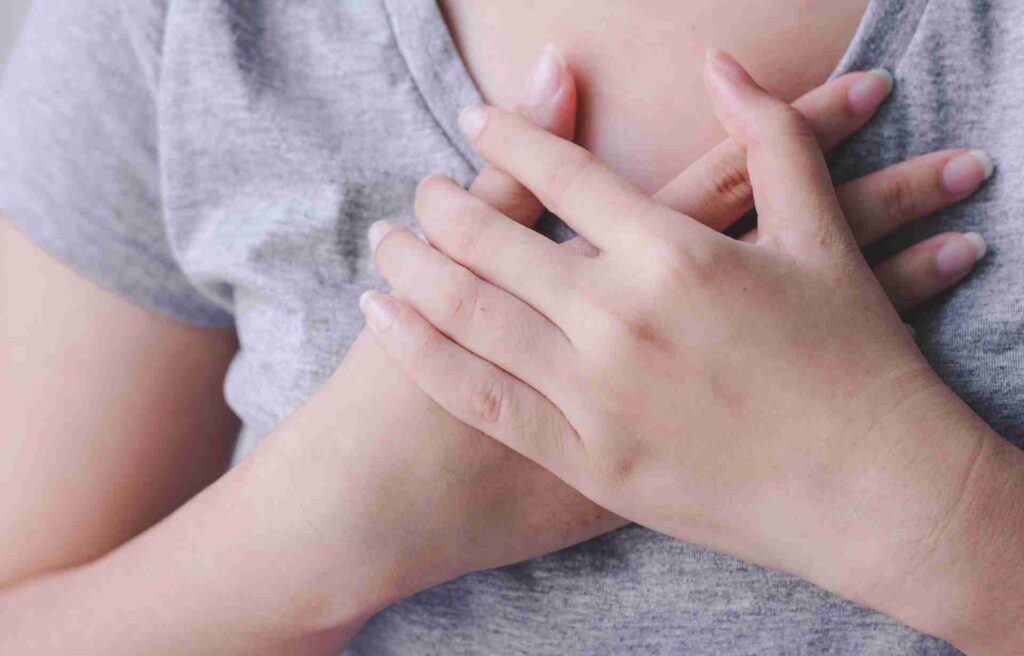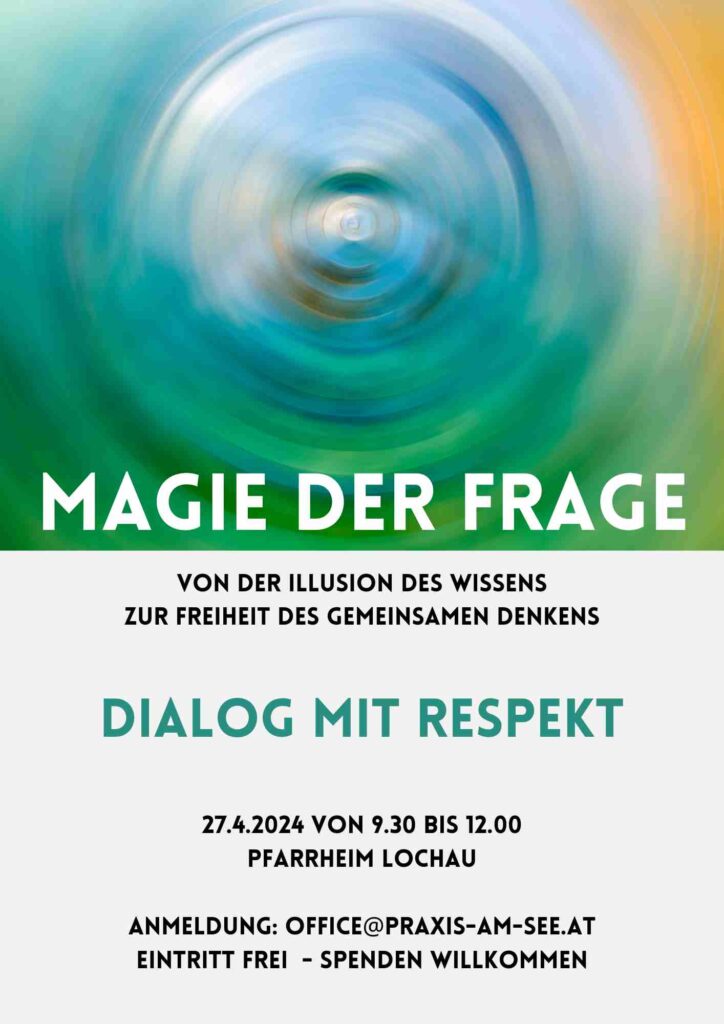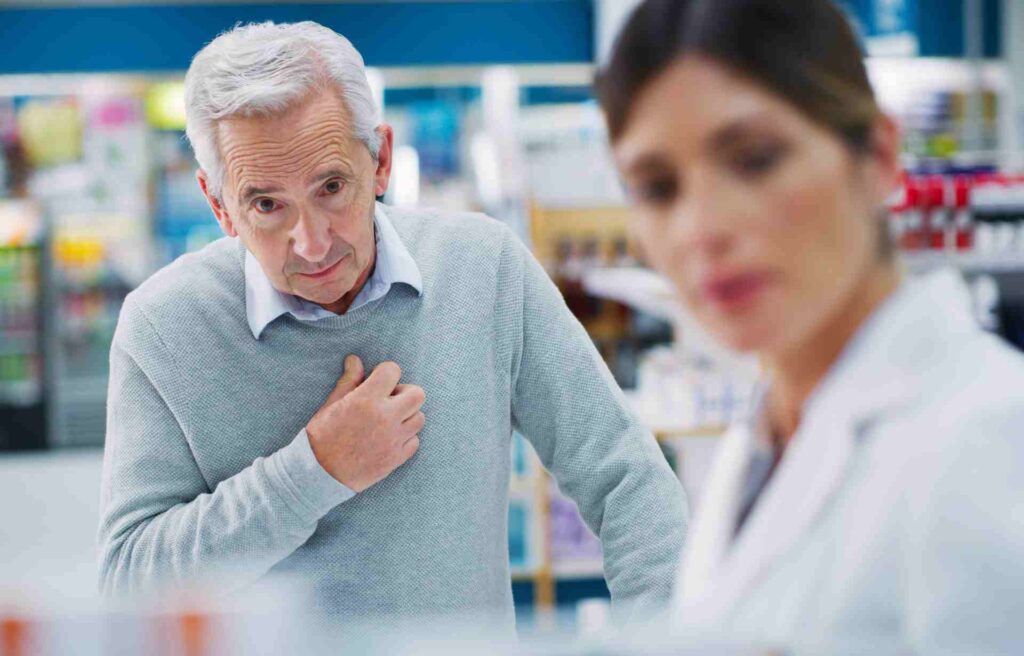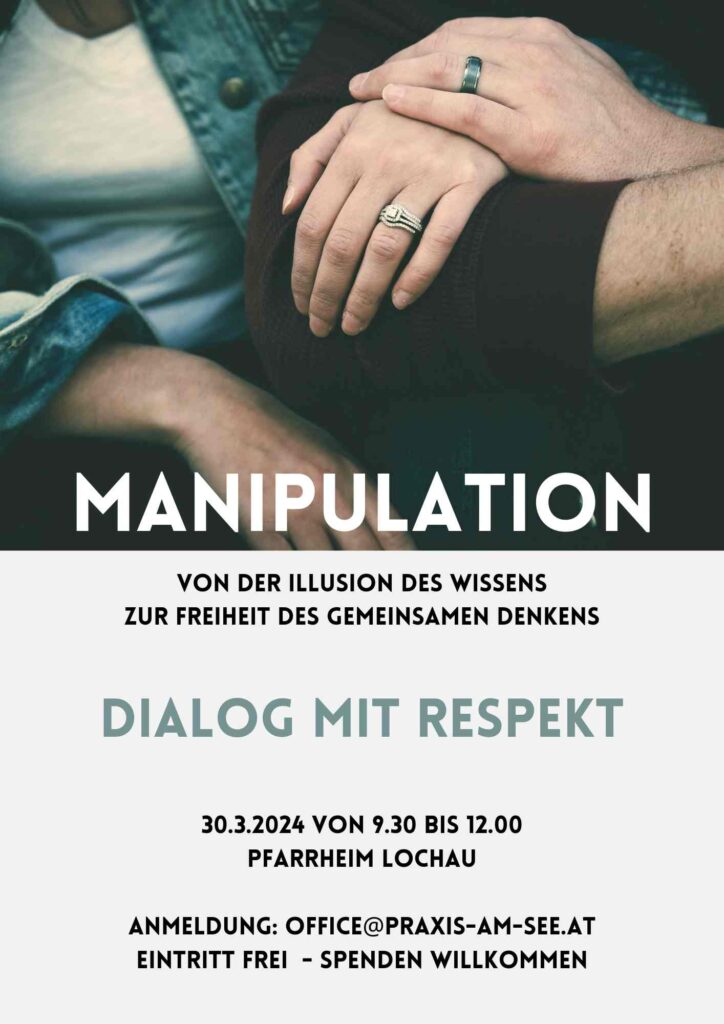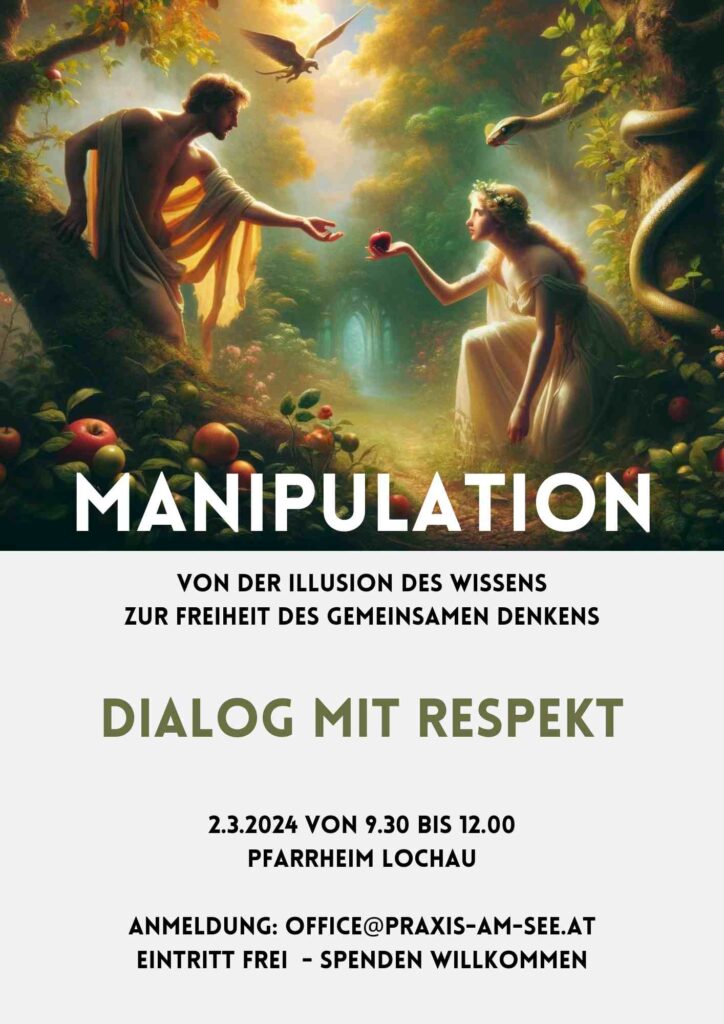Jemandem zu vergeben, durch den man Unrecht erfahren hat, ist nicht selbstverständlich. Manche Menschen leiden lebenslang an den ihnen zugefügten Verletzungen. Die Entscheidung, wie lange man sein Leben von erlittenem Unrecht steuern lässt, liegt jedoch in unserer Hand.
Anderen verzeihen zu können, steigert unser Wohlbefinden und lässt uns zufriedener, optimistischer, selbstbewusster und körperlich und seelisch gesünder sein. Das Immunsystem wird gestärkt, das Herz-Kreislauf-System geschützt. Angstzustände und Depressionen kommen deutlich seltener und weniger schwer vor. Doch nicht nur für uns selbst ist Vergebung eine wertvolle Handlungsoption, die wir öfter überdenken sollten, sondern auch für denjenigen, der das Unrecht begangen hat – auch wenn er meist nicht der erste ist, an den wir wohlwollend denken. Wer unter Druck steht, dass ihm nicht vergeben wird, der muss mit gesundheitlichen Folgen rechnen.
Auch wenn Verzeihen eine bewusste Entscheidung ist, bevor die Bereitschaft dazu da ist, erlebt man oft ein breites Gefühlsspektrum: Man kann traurig sein, verletzt, wütend, rachedurstig. So unangenehm diese Gefühle sind, sie helfen bei der Verarbeitung des Geschehenen und verschaffen den Abstand, den es braucht, um wieder auf den anderen zugehen zu können.

Die vier Phasen der Vergebung
Vergebung ist ein komplexer Prozess, der nicht über Nacht geschieht. Sie erfordert Zeit, Reflexion und emotionale Arbeit. In der psychologischen Literatur werden oft vier Phasen beschrieben, die Menschen durchlaufen, wenn sie sich auf den Weg der Vergebung begeben. Diese Phasen helfen zu verstehen, wie Vergebung funktioniert und welche Schritte notwendig sind, um zu einem Zustand des Friedens und der Versöhnung zu gelangen.
1. Verletzung und Schmerz
In dieser ersten Phase wird die Person, die Unrecht erfahren hat, mit den emotionalen und physischen Konsequenzen der Verletzung konfrontiert. Der Schmerz, die Wut und das Gefühl des Verrats sind oft intensiv und überwältigend. Die Anerkennung dieser Gefühle und das Eingeständnis, dass man verletzt wurde, sind entscheidende Schritte. Hier einige Aspekte dieser Phase:
- Anerkennung des Unrechts: Es ist wichtig, das Unrecht und den Schmerz anzuerkennen und nicht zu verdrängen.
- Emotionale Verarbeitung: Betroffene erleben intensive negative Emotionen, die verarbeitet werden müssen, bevor weitere Schritte unternommen werden können.
- Verstehen der Auswirkungen: Es wird deutlich, wie tief und auf welche Weise das Unrecht das Leben des Betroffenen beeinflusst hat.
2. Entscheidung zur Vergebung
Nachdem der Schmerz und das Unrecht anerkannt wurden, steht die betroffene Person vor der Entscheidung, ob sie vergeben möchte oder nicht. Diese Phase ist oft von inneren Kämpfen und Abwägungen geprägt. Einige Schlüsselpunkte dieser Phase sind:
- Bewusste Entscheidung: Vergebung ist eine aktive und bewusste Entscheidung, die getroffen werden muss.
- Abwägung von Vor- und Nachteilen: Die Person erwägt die potenziellen Vorteile der Vergebung gegenüber dem Festhalten an Groll und Wut.
- Motivation zur Vergebung: Die Gründe für die Vergebung können vielfältig sein, einschließlich des Wunsches nach innerem Frieden, der Verbesserung der eigenen psychischen Gesundheit oder der Wiederherstellung von Beziehungen.
3. Arbeit an der Vergebung
Diese Phase ist die intensivste und längste, da sie die eigentliche emotionale und kognitive Arbeit der Vergebung beinhaltet. Es geht darum, negative Emotionen loszulassen und eine neue Perspektive zu entwickeln. Wichtige Schritte in dieser Phase sind:
- Empathie und Perspektivwechsel: Sich in die Lage des Täters zu versetzen und dessen Beweggründe und Umstände zu verstehen, kann helfen, die negativen Gefühle zu mildern.
- Loslassen von Groll: Aktives Bemühen, Groll und Rachegefühle abzubauen und loszulassen.
- Selbstreflexion: Reflexion über die eigene Rolle und mögliche Beiträge zur Situation, ohne die Verantwortung des Täters zu mindern.
4. Freilassung und Wiederaufbau
In der letzten Phase der Vergebung geht es darum, die Beziehung zum Täter neu zu definieren und sich selbst von der Last des Grolls zu befreien. Dies kann zu einer vollständigen Versöhnung führen oder einfach zu einem inneren Frieden und einer neuen Perspektive. Aspekte dieser Phase umfassen:
- Freilassung des Täters: Der Täter wird emotional freigelassen, was nicht bedeutet, dass sein Verhalten gutgeheißen wird, sondern dass der Betroffene nicht mehr von negativen Gefühlen beherrscht wird.
- Wiederaufbau von Beziehungen: Wenn möglich und gewünscht, kann die Beziehung zum Täter neu aufgebaut oder neu definiert werden.
- Innere Heilung: Der Abschluss des Vergebungsprozesses führt zu einem Gefühl der Erleichterung, des inneren Friedens und der persönlichen Weiterentwicklung.
Die vier Phasen der Vergebung – Verletzung und Schmerz, Entscheidung zur Vergebung, Arbeit an der Vergebung und Freilassung und Wiederaufbau – bieten einen strukturierten Rahmen, um den komplexen und oft herausfordernden Prozess der Vergebung zu verstehen und zu durchlaufen. Jede Phase erfordert unterschiedliche emotionale und kognitive Ressourcen, aber gemeinsam führen sie zu einem Zustand des inneren Friedens und der emotionalen Freiheit. Vergebung ist somit nicht nur ein Akt der Gnade gegenüber dem Täter, sondern vor allem ein Weg zur eigenen Heilung und Selbstbefreiung.
Nicht immer laufen diese vier Phasen reibungslos ab. Manchmal fällt es schwer, sich wieder aus den starken negativen Gefühlen zu lösen. Andauernde Wut und Verbitterung aber belasten Körper und Seele: Es kommt zu Muskelverspannungen, Erschöpfung, Schmerzen, Herz-Kreislauf-, Magen-Darm- oder Schlafstörungen.
Manche Menschen tun sich leichter zu vergeben, andere denken lange und ausgiebig über Kränkungen nach und verletzen sich damit immer wieder selbst. Oft hängt das mit einem geringen Selbstwertgefühl zusammen. Wer unsicher ist, nimmt eine Situation schnell persönlich und bewertet sie eher negativ. Aber auch wenn man wirklich unfair behandelt wurde, ist es sinnvoll daran zu arbeiten, selbstbewusster zu werden und Grenzen zu setzen.

Gekränkte Gefühle lindern:
Folgende Überlegungen können dabei helfen, gekränkte Gefühle zu lindern:
- Habe ich richtig verstanden, was der andere gesagt oder getan hat? Habe ich durch Nachfragen mein Verständnis vertieft?
- Habe ich meinem Gegenüber meine Gefühle mitgeteilt? Habe ich gesagt wie es mir damit geht und was ich mir wünschen würde?
- Hab ich mich in den anderen hineinversetzt? Welche Gefühle und Motive stehen hinter seinem Verhalten? Gibt es eventuell sogar positive Motive oder hat das Verhalten gar nichts mit mir zu tun, sondern mit schlechter Stimmung oder einer Krisensituation?
- Habe ich Wirklichkeit und Bewertung auseinander gehalten?
- Welche Bedeutung will ich dem Ereignis beimessen? Will ich mich näher damit beschäftigen oder loslassen?
- Wie wichtig ist der Mensch, der mich verletzt hat, in meinem Leben? War es ein Ausrutscher oder versucht er immer wieder mich zu verletzen?
Ist Vergebung immer der richtige Weg?
Während sich die Psychologie auf eine versöhnliche Reaktion auf Verletzungen konzentriert, ergibt sich aus philosophischem Blickwinkel ein zentrales Problem: das Spannungsverhältnis zwischen Vergebung und Gerechtigkeit. Kann echte Gerechtigkeit erreicht werden, wenn Vergehen vergeben werden, oder untergräbt Vergebung die Forderung nach moralischer und rechtlicher Verantwortung? Wer anderen etwas antut, soll ja nicht einfach ungeschoren davonkommen.
Auch die Psychologie beschäftigt sich heute verstärkt mit diesen Aspekten. Verzeihen kann beispielsweise kontraproduktiv werden, wenn der Konflikt andauert. So müsste man die andauernden Kränkungen wieder und wieder verzeihen. Auch bei sehr starken Kränkungen wird diskutiert, ob es für einen Menschen wichtig sein kann, unversöhnlich zu bleiben, um die eigene Unversehrtheit zu schützen. Zu schnelles Verzeihen könnte auch zum Trivialisieren von Unrecht führen und zum Vergessen von Normverstößen, die weiter im kollektiven Bewusstsein gehalten werden sollen.
Vergeben, vergessen, versöhnen
Wer verzeiht, zeigt damit dem anderen nicht, dass er sich richtig verhalten hat. Verzeihen bedeutet auch nicht vergessen zu müssen. Und es ist auch kein Zeichen von Schwäche. Primär tut man es um seiner selbst willen. Der andere muss es sich nicht verdienen, dass man ihm verzeiht. So wird das Verzeihen von der Akzeptanz des Unrechts an sich unterschieden. Es ist zwar geschehen, aber dieses akzeptieren ist kein Freibrief, es immer wieder zu tun.
Amnesie und Amnestie haben denselben altgriechischen Wortstamm λανθάνω (vergessen). Während es sich bei ersterem um eine Gedächtnisschwäche handelt, ist letzteres ein absichtliches Vergessen in Form von Straferlass. Verzeihen bedeutet aber weder vergessen noch zu verdrängen, weshalb es in der tiefenpsychologisch orientierten Arbeit darum geht, Verdrängtes aufzufinden und ins bewusste Leben zu integrieren.
Versöhnung geht sogar noch einen Schritt weiter als nur auf Rache und Wiedergutmachung zu verzichten. Eine Annäherung fällt oft leichter, wenn ein entsprechendes Schuldeingeständnis und eine Reuebekundung stattgefunden hat. Ohne diesen Schritt bleiben können keine Brücken gebaut werden.

Zuletzt: Sich selbst vergeben
Ob man anderen nicht verzeiht oder sich selbst – die negativen Konsequenzen bleiben dieselben.
Jeder macht Fehler. Sie sind ein unverzichtbarer Schritt des Wachstums. Deshalb ist es wichtig aus Fehlern zu lernen, sich selbst zu verzeihen und nach vorne zu schauen.
Sich einen Fehler einzugestehen, anstatt das eigene Verhalten zu rechtfertigen, ist der Beginn des heilsamen Prozesses. Neben Wut und Trauer mag es auch sein, dass man sich mit Schuld oder Scham konfrontiert sieht. Diese Gefühle können der Katalysator sein für Reue und eine Verhaltensänderung. Wichtig ist dabei jedoch zwischen Tat und Täter zu unterscheiden. Wird der Selbstwert nur über sein Verhalten definiert, gerät man in Gefahr diesen mehr und mehr zu verlieren, wenn man sich zu seinen Taten bekennt. Eine Geste der Wiedergutmachung – auch gegenüber sich selbst kann hilfreich sein, um die Balance wiederherzustellen.

Literatur:
Boshammer, Susanne (2020): Die zweite Chance – Warum wir (nicht alles) verzeihen sollten. Hamburg: Rowohlt Verlag
Fücker, Sonja (2020): Vergebung: Zu einer Soziologie der Nachsicht. Frankfurt am Main: Campus Verlag
Wolf, Doris (2017): Ab heute kränkt mich niemand mehr. 101 Power-Strategien, um Zurückweisung und Kritik nicht mehr persönlich zu nehmen. München: PAL Verlag
Verzeihen, Versöhnen, Vergessen: Soziologische Perspektiven Morikawa, Takemitsu (Ed.)
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/70083/ssoar-2018-morikawa-Verzeihen_Versohnen_Vergessen_Soziologische_Perspektiven.pdf Abrufdatum: 10.8.24
Wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt
www.deutschlandfunkkultur.de/kunst-und-grenzen-des-verzeihens-wenn-die-zeit-nicht-alle-100.html Abrufdatum: 10.8.24